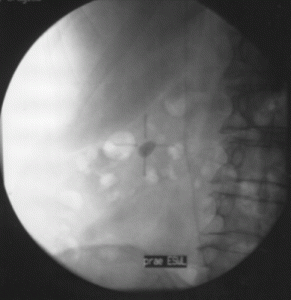Steinerkrankungen
Harnsteine können im gesamten Harntrakt vorkommen. So spricht man u.a. von Nierensteinen, Harnleitersteinen und Blasensteinen. Auch im Kindesalter kommen Harnsteine vor.
Wir finden Harnsteine im Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase und Harnröhre.
In den letzten Jahren kam es zu einen deutlichen Anstieg der Steinerkrankungen, auch bestehen bei der Steinerkrankung erhebliche regionale Unterschiede, so ist die Steinerkrankung, besonders mit Harnsäuresteinen im Süden Deutschlands häufiger als im Norden, auch ist die Steinerkrankung in Deutschland z.B. häufiger als in Großbritannien.
Im Jahr 2000 lag die Häufigkeit der Steinerkrankungen bei ca. 1,2 Millionen Menschen, Männer sind etwas doppelt so häufig betroffen wie Frauen, die Steinerkrankung kommt auch familiär gehäuft vor, so dass bei bekannter Steinerkrankung in der Familie eine frühzeitige Untersuchung sinnvoll ist.
Harnsteine können nur als Grieß vorkommen und sehr klein sein, aber nur stecknadelkopfgroße Steine können heftige kolikartige Schmerzen auslösen, auf der anderen Seite gibt es auch das gesamte Nierenbecken ausfüllende so genannte Ausgusssteine.
Auch unklare Flankenschmerzen und Fieber sollten sofort urologisch abgeklärt werden.
Aber auch eine einfache Urinuntersuchung beim Hausarzt mit dem Nachweis auf Blut im Urin kann als Ursache eine Steinerkrankung haben.
Die erste Untesuchung nach Arztgespräch und Urinuntersuchung ist eine Ultraschalluntersuchung der Niere und der ableitenden Harnwege.
Nach Schmerzfreiheit folgt die weitere Abklärung mit einer Röntgenkontrastmitteluntersuchung (sollte eine bekannte Allergie gegen Kontrastmittel vorliegen teilen Sie dies unbedingt Ihrem behandelnden Urologen mit, ebenso ist es wichtig, ob der Patient Methylharnstoffe zur Behandlung der Zuckerkrankeheit einnimmt.
Bei einer Allergie oder erhöhten Nierenwerten kann auch eine so genannte retrograde Darstellung der Niere und des Harnleiters erfolgen, hierbei wird Kontrastmittel über die Blase in die Harnleiterostien eingespritzt, im gleichen Arbeitsgang können auch Harnleiterschienen bei z.B. einer Stauung der Niere eingelegt werden.
Die Behandlung der Harnsteine ist vielfältig, nach der genauen Diagnose durch Ihren Urologen besteht z.B. bei kleinen, abgangsfähigen Steinen die Möglichkeit, dass die Steine auf natürlichem Wege von selbst abgehen („Spontanabgang“), wichtig ist hier die Steine mit einem Sieb aufzufangen und Sie so einer Steinanalyse zuzuführen.
Zur Behandlung der Harnleitersteine stehen uns modernste endoskopische Verfahren zur Verfügung, mit Hilfe dünner, semiflexibler und flexibler Instrumente können die kleineren Steine vollständig entfernt werden, größere Steine werden mit dem neuen, innovativen Steinlaser (Medilas H 20 Fa. Dornier) schonend vor Ort in kleinste Teile zertrümmert, im Anschluss sorgt eine dünne Silikon-Harnleiterschiene für einen freien Abfluss des Urins von der Niere zur Blase.
Nierensteine können mit der sog. ESWL-Behandlung (extrakorporale Stoßwellen-Lithotripsie) berührungsfrei von außen in kleine Steinteile oder Sand zertrümmert werden, hierzu werden die Steine mit Ultraschall oder Röntgen geortet. Diese Behandlung erfolgt meist ambulant. Wir verwenden das neuste Gerät der Fa. Dornier zur Lithotripsie.
Seltener ist bei Nierensteinen eine sog. Perkutane Steinoperation nötig, hierzu wird die Niere von der Flanke her punktiert, es wird ein Kanal in das Nierenbeckenkelchsystem hinein aufgedehnt und eine Optik eingeführt. Die Steine können dann in der Niere zertrümmert und abgesaugt werden. Dieser Eingriff erfordert eine Narkose.
Die offene Steinoperation kommt nur sehr selten bei ausgedehnten Nierenbeckenausgusssteinen zur Anwendung, eine offene Operation bei Harnleitersteinen mussten wir in den letzten Jahren nicht mehr durchführen, diese Eingriffe müssen aber beherrscht werden.